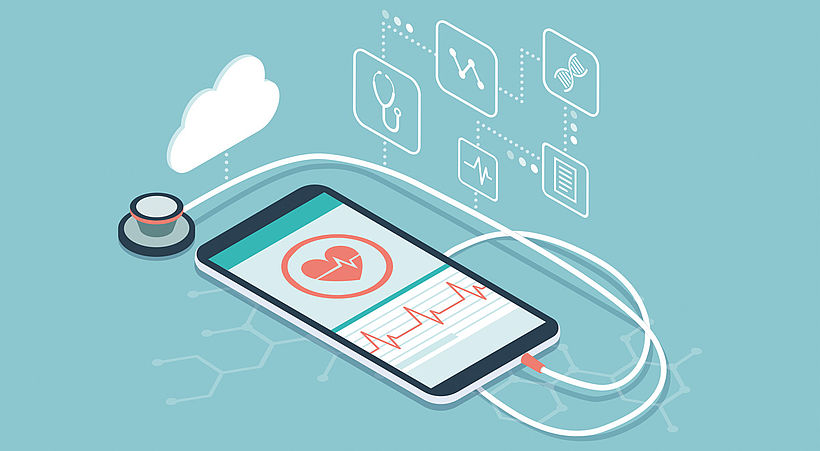Digitale Therapien, das könnte ein neues Marktsegment im Gesundheitswesen werden, ein Markt, der in den nächsten Jahren auf einige Milliarden US-Dollar anwachsen könnte. Viele Start-ups, aber auch Schwergewichte aus der Pharmaindustrie tummeln sich in diesem Feld. Ist es mehr als nur eine Projektionsfläche für Heilsversprechen aller Art?
Vorsicht: Wenn Sie Software entwickeln, die auf mobilen Endgeräten benutzt werden kann, um Patienten mit psychiatrischen oder neurologischen Erkrankungen zu behandeln, dann sollten Sie sich gut überlegen, ob Sie den Begriff „digital therapeutics“ benutzen wollen. Zumindest in den USA hat sich die „Click Therapeutics Inc.“ (kein Witz) den Begriff schon 2012 als Marke schützen lassen. Sanofi Ventures hat erst im Juli 2018 die Summe von 17 Millionen US-Dollar in dieses Unternehmen aus New York investiert, das unter anderem an einer digitalen Raucherentwöhnung, einer App gegen Schlafstörungen, zur Unterstützung bei chronischen Schmerzen und gegen Depressionen arbeitet. Eine Investition in einen Markt, der laut Analysten bis 2025 auf über neun Milliarden US-Dollar anwachsen soll.
Informatiker unterscheiden traditionell gern transaktionale und analytische IT. Bei erstgenannter geht es um die Steuerung von Prozessen, zum Beispiel einer Patientenaufnahme, einer Kostenerstattung oder auch um eine klinische Dokumentation. Bei der zweiten steht der analytische Teil im Vordergrund, etwa wenn mit „Business Intelligence Lösungen“ existierende Daten genauer analysiert, aggregiert, gefiltert und häufig visuell unterschiedlich dargestellt werden. Der „vernetzende“, transaktionale Charakter in der Medizin wird wohl eher durch Begriffe wie „eHealth“ dargestellt, der analytische Teil durch Konzepte wie „big data“.
Und was ist mit „digital therapeutics“ (DTX)? Wo passen die hinein? Es soll jetzt keine Definition erfolgen, und zwar genau deshalb, weil der Kern dieser Begrifflichkeit die Unschärfe ist, eine Projektionsfläche, in die verschiedene Ideen, Ängste und Hoffnungen projiziert werden können. Zu betonen ist, dass es sich sicherlich von den gänzlich unscharfen Begriffen wie „digital health“ oder „Internetmedizin“ dahingehend unterscheidet, dass es um eine Untergruppe von Anwendungen mit dem klaren Fokus auf Therapie geht. Das beinhaltet einen analytischen Teil („big data“),
zudem aber auch noch eine Intervention, und die kann bei einer rein digitalen Anwendung nur die „richtige Information am richtigen Ort zur richtigen Zeit“ sein. Wir reden also von „information therapy“, was suggeriert, dass die verständliche und verstandene Information so wirksam und effektiv sein kann wie ein Medikament selbst.
Im Jahr 2015 tauchte der Begriff „digital therapeutics“ das erste Mal in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift Journal of Medical Internet Research auf: „Digital Therapeutics sind evidenzbasierte Online-Verhaltenstherapien, die den Zugang zum und die Effektivität im Gesundheitssystem verbessern können“, hieß es dort, vom Autor übersetzt.[1] Doch manche „digital therapeutics“ wollen weit darüber hinausgehen. Sie sehen sich gar nicht so sehr als „Therapeutika“ – und damit als Teil eines umfassenderen Behandlungsansatzes –, sondern als Therapie selbst.
Stehen DTX also auf derselben Stufe wie Medikamente? So sehen es mittlerweile einige Strategen aus der Pharmaindustrie: Jeremy Sohn, Vice President und Global Head of Digital Business Development bei Novartis sagt: „Digital therapeutics, like pills, are just another kind of treatment.“ Damit sieht er DTX nicht nur als digitale Unterstützung beim Medikationsprozess, was häufig auch „beyond the pill“ genannt wird, sondern er prognostiziert eine neue Produktklasse. Das mag für den einen oder anderen nur wie aufgeblähte digitale Versprechungen und Zukunftsmusik klingen. Dabei sind DTX schon jetzt evidenzbasiert wirksam gegen oder bei recht spezifischen Indikationen. Offen ist, ob Ärzte und Ärztinnen zukünftig Patienten zum Kollegen Computer nach Hause schicken oder ob der Patient diesen Weg einfach selbst findet.
Ein Beispiel ist die internetbasierte kognitive Verhaltenstherapie: Bereits Anfang der Neunzigerjahre wurden erste Versuche unternommen, und vor rund 15 Jahren eine der ersten randomisiert-kontrollierten Studien in der Zeitschrift Journal of Medical Internet Research publiziert. Als dann schnell weitere Arbeiten folgten, erschienen die ersten Metaanalysen unter anderem in „JAMA“ und „Der Nervenarzt“. Die meisten Studien fanden einen moderaten Erfolg der Therapie – und eine weitgehende Gleichwertigkeit mit der herkömmlichen Psychotherapie in Anwesenheit eines Therapeuten. Das mag für den ein oder anderen Psychologen überraschend oder sogar schwer akzeptierbar sein. Aber bei Wartezeiten in Ballungszentren von über sechs Monaten auf einen „physischen“ Therapieplatz ist es vielleicht doch schon bald eine echte Alternative.
Aber warum werden diese digitalen „Mittelchen“ denn dann – obwohl die Evidenzlage teilweise recht gut ist – noch nicht so häufig eingesetzt? Hier gibt es eine Vielzahl von Gründen: Erstens lassen sich DTX auf den ersten Blick nur schwer von den Hunderttausenden von Wellness- und Fitness-Apps unterscheiden. Und leider existiert eine Menge digitaler Quacksalberei in den App-Stores dieser Welt, die mit leeren Versprechungen (gewollt oder ungewollt) daherkommen und sich von echter evidenzbasierter Software auf dem digitalen Marktplatz nur schwer differenzieren.
DTX finden auch zurzeit noch keinen leichten Zugang in das (deutsche) Gesundheitssystem. Zum einen lassen sie sich in der Regel nicht einfach in die Regulatorik des deutschen Medizinproduktegesetzes oder des europäischen Medizinprodukterechts einbinden. Einer der Gründe ist, dass die Agilität der Softwareentwicklung schwer mit der gewünschten „Stabilität“ klassischer Medizinprodukte in Einklang zu bringen ist. Zum anderen sind die Erstattungsmöglichkeiten im deutschen Markt teilweise noch recht begrenzt. Ein Selbstzahlermarkt ist nur gering ausgeprägt, sodass ein reines Endkundenmarketing nicht funktioniert. Für viele Krankenkassen sind diese Bereiche (noch) eher Marketinginstrumente, die gern auch mal mit einer sechs- bis zwölfmonatigen Exklusivität eines Selektivvertrags verbunden werden.
Und der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)? Nun, er ist zwar mit entsprechendem Formblatt gemäß der Verfahrensordnung und der Gebührenordnung ansprechbar – im Leistungskatalog finden sich derzeit allerdings noch keine digitalen Therapien. Ob der G-BA methodisch, inhaltlich und personell gut dafür aufgestellt ist, wird die Zukunft zeigen. Zwar scheint man sich dort mit DTX zu beschäftigen – wie zuletzt auf einem EBM-Symposium in Wittenberg im September 2018 zu hören war. Aber in welchem Zeitraum hier klare Prozesse aufgestellt werden, ist zurzeit noch unklar. Methodisch gibt es zudem noch offene Fragen, welches Studiendesign und welche klinischen Endpunkte von wem und wie gemessen werden sollen. Wie sieht zum Beispiel eine valide doppelblinde Studie im digitalen Zeitalter aus? (Dafür gibt es im internationalen Kontext sehr gute Beispiele.) Und wer misst den Erfolg? Wenn kein Experte zugegen ist, werden möglicherweise gerade individuelle Patienteneinschätzungen (patient reported outcomes) an Bedeutung gewinnen.
Prinzipiell können DTX entweder bestehende Therapien ergänzen oder als eigenständige Therapien auftreten, die existierende Therapien ersetzen oder in Bereichen, in denen es noch keine Therapien gibt, als alleinige therapeutische Maßnahme eingesetzt werden können. Therapieergänzende DTX finden sich beispielhaft im Bereich Diabetes. Das Pharmaunternehmen Roche hat nicht zuletzt deswegen viele Millionen in die diabetische Vernetzungs-App „mySugr“ investiert, um an Echtdaten von Nutzern und Nutzerinnen zu kommen, die eine moderne Diabetestherapie weit umfassender verstehen als die traditionelle Diabetesversorgung.
Anders verhält es sich bei DTX, die explizit bestehende Therapieformen ersetzen wollen. Dass dies teilweise mit dem Widerstand derer verbunden ist, denen möglicherweise ein Stück vom Kuchen abgeschnitten werden wird, versteht sich von selbst. Zusätzlich zu diesen ökonomisch motivierten Widerständen stellen diese DTX das Selbstbild des unersetzbaren, einzigartig menschlichen Therapeuten infrage. Es gibt in Deutschland zahlreiche Vorreiter dieser zweiten Variante digitaler Therapien:
- Mit dem Schlagwort „App auf Rezept“ wurde Caterna – eine digitale Lösung für schielende Kinder – auf allerlei Kongressen gewürdigt. Eine Krankenkasse, die eine „App“ bezahlt? Die Barmer hatte einen Marketingclou gelandet. Allerdings scheint der Vertriebsweg über Krankenkassen noch nicht wirklich zu funktionieren. Denn aktuell sind laut der Website von Caterna (Aufruf September 2018) erst rund „500 Behandlungen erfolgreich durchgeführt worden – bei über 200 beteiligten Augenarztpraxen“. Das könnte auf ein Positionierungsproblem oder eines der medizinischen Evidenz hindeuten. Eine aktuelle Crowdfunding-Kampagne will nun auf „b2c“ zielen – also auf den Direktvertrieb an betroffene Eltern und deren Kinder. Wie erfolgreich dies sein wird, ist offen.
- „Tinnitracks“ will mit Lieblingsmusik gegen Tinnitus helfen und hat einen klaren Fokus auf Bezahlung durch gesetzliche und private Krankenkassen. Ein Selbstzahlerpreis ist auf der Website nicht zu finden. Zudem finden sich auf der Website eine beeindruckende Zahl von Studien, die zum Beleg der Therapie herangezogen werden können. Offen ist, ob die Partnerschaft mit einem Hersteller von Kopfhörern eine strategisch richtige Entscheidung war. Ein Stück Hardware kann nicht nur den Vertriebsweg erschweren, sondern auch bei regulatorischen Fragen Komplikationen mit sich bringen.
- „Speechagain“ ist eine digitale Stottertherapie, die aus der Zusammenarbeit des größten europäischen Stottertherapiezentrums in Kassel mit dem Company Builder „Digital Health Factory“ aus Berlin entstanden ist. Sie gehen einen anderen Weg: Nach der technischen Entwicklung und Erprobung mit deutschsprachigen stotternden Menschen wird das Produkt, das im Kern eine Sprecherkennung mit modernen Algorithmen ermöglicht, nun primär in den USA vermarktet. Besonders ist auch, dass explizit die Empfehlungen der S3-Leitlinie digital umgesetzt werden.
- „Flyhappy“, ebenfalls Digital Health Factory, nutzt die erst seit Mai 2018 auf dem Markt befindliche „next generation virtual reality“-Technologie, um Patienten mit Flugangst orts- und zeitunabhängig zu therapieren. Entwickelt wird eine „digitale Verhaltenstherapie“, die auf hoher Evidenz basierend eine neue Therapieform marktfähig machen soll.
Am Ende ist entscheidend, dass DTX die Akzeptanz der Patienten und Patientinnen beziehungsweise der Nutzer und Nutzerinnen haben sowie idealerweise der „verschreibenden“ Ärzte und Ärztinnen. Dafür wird die digitale Kompetenz im Sinne einer digital health literacy sicherlich noch weiterwachsen müssen.
Gelingt dieser Bewusstseinswandel, dann ergeben sich für eine Vielzahl von Playern im (deutschen) Gesundheitssystem neue Chancen: Vielleicht gibt es in viel kürzerer Zeit, als wir uns vorzustellen vermögen, Online-Apotheken, in denen digitale Therapien angeboten werden? Möglicherweise verstehen Unternehmen der Pharmaindustrie und der Medizintechnik, dass hier ein ganz neues Marktsegment entsteht? Oder ein anderer „non traditional player“, also ein Anbieter, der zurzeit gar nicht primär Gesundheitsleistungen anbietet, findet neue Marktchancen – dies könnte etwa ein IT- oder Telekommunikationsunternehmen sein.
In den USA hat sich kürzlich die „Digital Therapeutics Alliance“ gegründet, die das Verständnis von DTX vorantreiben will. Den beteiligten Unternehmen ist klar, dass es sich idealerweise um globale und skalierbare Produkte handeln muss, die im Vergleich zu klassischer Pharma und Medizintechnik mit extrem kurzen und günstigen Entwicklungszeiten auftrumpfen können. Zudem adressieren sie teilweise, wie das Beispiel Stottern zeigt, ein Marktsegment, das von dem traditionellen Gesundheitssystem gar nicht abgedeckt werden kann. In einer Vielzahl von Ländern reicht die Anzahl von Logopäden schlicht nicht aus, oder diese sind nur schwer erreichbar oder zu teuer.
DTX werden sich durchsetzen, wenn sie evidenzbasierte Konzepte umsetzen und Vertriebswege finden, die dieser neuen Produktklasse angemessen sind. DTX können mehr als „software as drug“ sein, wenn sie kommunikative, interaktive, kollaborative und informative Elemente einbauen und die Möglichkeiten agiler Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Patienten und Patientinnen sowie den therapeutischen Experten nutzen. Hoffentlich nutzen zudem die etablierten Player und die Politik die Chance und erkennen, dass DTX zur Modernisierung teilweise verkrusteter Strukturen und Prozesse eines Gesundheitssystems beitragen können.
[1] Sepah, Cameron S.; Jiang, Luohua; Peters, Anne L. (2015). „Long-Term Outcomes of a Web-Based Diabetes Prevention Program: 2-Year Results of a Single-Arm Longitudinal Study“. Journal of Medical Internet Research. 17 (4): e92. doi:10.2196/jmir.4052.
Autor: Dr. med. Peter Langkafel MBA
Gründer und Geschäftsführer von Digital Health Factory, Berlin